Der Neurowissenschaftler John O’KEEFE vom University College in London erforschte in den späten 1960er Jahren die Aktivität von Hirnneuronen in lebenden Tieren mit implantierten Elektroden. Anders jedoch, als andere hirnforschende Wissenschaftler, testete er experimentell nicht allein einfache Reize, um eine Auflistung von Reaktionen einzelner Hirnneurone zu erstellen. O’Keefe ließ Ratten in einem kleinen Labyrinth einfach das tun, was diese gerade machen wollten. Es war nichts Weltbewegendes, denn seine Nagetiere wollten meist einfach nur umherlaufen. Der Neurowissenschaftler beobachtete unterdessen, was sich zeitgleich in der Hirnregion des Ratten-Hippocampus abspielte. Ihn verblüffte, dass er dort auf eine Art von Zellen stieß, die offenbar ganz anders funktionierten als all die anderen bis dahin bekannten Neurone.
Jene grauen Zellen, so stellte der Forscher 1971 fest, hatten offenbar allein die Funktion, die Position der Ratte im Irrgarten zu lokalisieren. Heißt: Jeweils nur eine Zelle reagierte immer dann, wenn ein Tier einen bestimmten Ort erreicht hatte und O’Keefe vermutete, dass so aus vielen dieser sog. „Ortszellen“ langsam aber sicher eine Karte der Umgebung entsteht, die seinen Versuchsobjekten eine Art Gefühl für den derzeitigen Aufenthaltsort gab. Zugleich scheint die Kombination vieler Ortszellen der Ratte klarzumachen, in welchem Lebensraum sie sich gerade bewegt: ist es das gewohnte Käfigumfeld oder eben das Labyrinth. Erinnerung hat also durchaus eine Ortskomponente, ist daher keine Leistung nur eines Hirnbereichs sondern eine Interaktion verschiedenster grauer Zellen.
Etwa drei Jahrzehnte nach O’Keefes ersten Erkenntnissen hatten Hirnforschende auf der ganzen Welt zwar immer mehr Details über die neuronalen Grundlagen des Ortsgefühls herausgefunden und gesammt. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts waren zusätzlich auch noch sog. „Kompasszellen“ bekannt, die bei einer nach oben gerichteten Kopfhaltung unbemerkt vom Bewusstsein Himmelsrichtungen registrierten, und „Wandzellen“, die das Raumgefühl mit Informationen erweitern, wie sich ein Individuum weitgehend unbewusst rechts oder links an einem Hindernis entlangbewegen könnte. Wie sich jedoch all diese unzusammenhängenden Einzel-Infos im Denkorgan zu einer Art Navigationssystem verknüpfen, war zu dieser Zeit noch unbekannt – bis das norwegische Ehepaar May-Britt und Edvard MOSER mit seinen Forschungsergebnissen an die Öffentlichlkeit trat: Erkenntnisse, die ihnen letztlich gemeinsam mit O’Keefe einen Nobelpreis einbrachten.
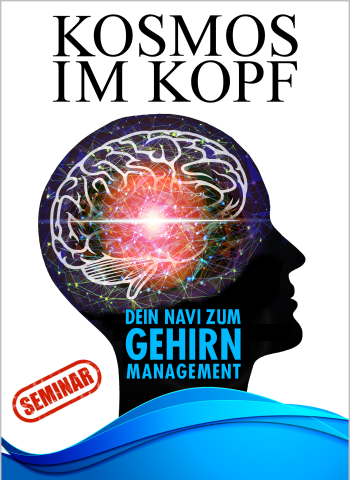
Beide hatten zuvor als neuroanatomische Experten für den entorhinalen Kortex empfohlen, der Area entorhinalis, einem Hirnrindenfeld am Schläfenlappen des Großhirns und damit eine dem Hippocampus benachbarte Hirnregion. Ebenso wie O’Keefe arbeiteten sie mit Ratten als Versuchstieren und die Area entorhinalis war für die Mosers deshalb interessant, da sie offenbar eng mit dem Ortszellenareal des Hippocampus interagierte. Da dieser Bereich jedoch nur schwer zu untersuchen war, ohne den Ratten beim Einführen der Elektroden zur Hirnstrommessung schwere Verletzungen beizufügen, konzentrierten sich die Mosers anfangs aus Respekt vor den Tieren darauf, technische Möglichkeiten zu entwickeln, die das Verletzungsproblem so weit als möglich umgehen können. Als dies 2005 geschafft war, stießen May-Britt und Edvard Moser auf einen Typ von Neuronen, die in ihren Aktionen einerseits den Ortszellen recht ähnlich waren, andererseits allein Infos über die verschiedenen Punkte eines Raums sammelten. Damit formten sich im entorhinalen Kortex Raumpunkte zu einem regelmäßiges Gitternetz mit konstanten Abständen, weshalb man diese Zellen „Rasterzellen“ oder „Gitterzellen“ nannte.
Das Hirnstrommuster der Gitterzellen, so die Erkenntniss der Forscherehepaars, bleibt bei dem Versuchstier vertrauten Orten auf Dauer stabil, bildet sich aber beim Erkunden einer neuen Umgebung sehr rasch neu aus. Vergrößert sich das Areal, in dem die Ratte sich bewegt, erweitert sich ebenso das Hirnstrommuster, sodass man davon ausgehen muss, dass die Area entorhinalis ein Netz aus immer mehr Hexagonalwaben auf eine abstrakte innere Hirnkarte projiziert. Anders jedoch, als bei den Ortszellen, die Veränderungen aufnehmen, bleibt die Landkarte der Rasterzellen erstaunlich konstant, selbst wenn sich Äußerlichkeiten der Umgebung ändern, etwa Farben einzelner Orientierungspunkte. Und die Mosers fanden heraus, dass sich das Netzraster auch nicht durch die Bewegungsrichtung und Laufgeschwindigkeit eines Versuchstiers veränderte.
Was im Hippocampus und dem entorhinalen Kortex geschieht, ist zwar im engeren Sinne mit dem vergleichbar, was wir auf unserm Handy sehen, wenn wir dort auf einer Karte oder Luftbildaufnahme angezeigt bekommen „Sie sind genau hier!“ und der Standort bewegt sich mit uns weiter, wenn wir uns durch Laufen oder Fahren bewegen. Darüber hinausgehend befand das Nobelkomitee die bahnbrechenden Forschungsergebnisse des Trios als besonders auszeichnungswürdig, weil sie wohl als Modell für allgemein vernetzte und interagierend arbeitende Funktionsweisen unseres Denkapparats dienen. Beispielsweise könnte das Gedächtnis Erinnerungen auf ähnliche Weise nicht nur als zeit- unud ortskodierende Information aus den Tiefen des Kopfes hervorholen, sondern diese werden zusätzlich „angereichert“ mit Gefühlen, Gerüchen oder bislang unbemerkt abgelegtem Wissen. Gut möglich also, dass die Bildung unseres Gedächtnisses seit unserer Geburt, unsere Zeitwahrnehmung, Beziehungen zu Mitmenschen, Ängste und Glücksgefühle oder die Orte unseres Lebens – also auf den ersten Blick sehr unterschiedliche Denk-Prozesse – auf ganz ähnlich schematisierten neuronalen Abläufen beruhen, wie bei O’Keefs und Mosers Ratten.

